Geschichte
Unsere traditionsträchtige Geschichte. Seit 1357 im Dienste der Schifffahrt.
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die St. Niklausen Schiffgesellschaft Genossenschaft nach ihrer langen, von Hochs und Tiefs geprägten Geschichte in der Gegenwart als ein junges, starkes und erfolgreiches Luzerner Unternehmen präsentiert. Mit einer grossen, zufriedenen Kundschaft, bestehend aus Hobby-Kapitänen, Schiffsführern, Segelfreunden und allen, die den Wassersport auf unserem Vierwaldstättersee lieben. Der eine oder andere Grund für die Entstehung dieses Erfolgs führt unsere Chronik zutage.
Meilensteine der SNG
1357 bis 2023
Geniessen Sie 666 Jahre nautische Leidenschaft zusammengefasst in 10 Minuten
Unser Jubiläumsfilm 1357 bis 2023
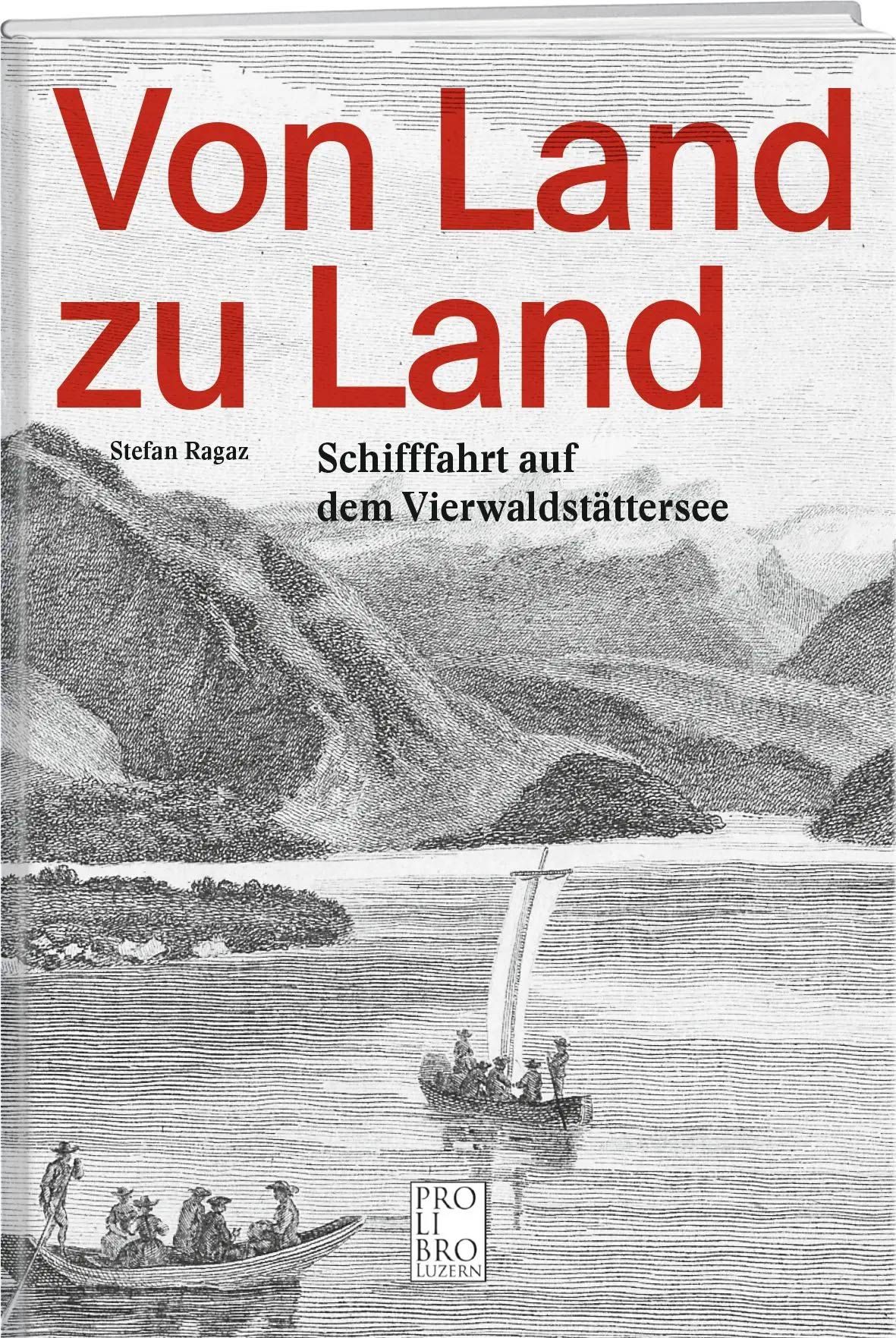
Von Land zu Land
Inhalt
Seit tausend Jahren ist die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee bestätigt – zunächst als Teil eines ausgedehnten Versorgungsnetzes der grossen Klöster, dann als Streitzone der Obrigkeiten an beiden Enden des Sees. Gestritten wurde während Jahrhunderten – über Geld und Einfluss, über Versorgungskanäle und über Rechtsauffassungen. Auf dem See tobte sogar ein hundertjähriger (Zoll-)Krieg. Das fundierte wissenschaftliche Buch, das in einem leicht lesbaren Stil geschrieben und reich illustriert ist, beleuchtet die Geschichte bis zur Ankunft der Dampfschifffahrt. Es vertieft die wirtschafts- und machtpolitischen Hintergründe wie auch die sozialgeschichtlichen Aspekte. Und es erzählt Geschichten: Wie endete eine angebliche Seeschlacht vor Stansstad? Warum wurde die Grösse von Schiffen in Pferden gemessen? Was hatte ein Obelisk auf einer Insel vor Luzern zu suchen? Warum wandte sich Küssnacht von Luzern ab? Was machten die Schiffleute, wenn der See zufror? Und: Wie sahen die mittelalterlichen Schiffe überhaupt aus?
Stefan Ragaz
Stefan Ragaz (64), Historiker und Journalist aus Luzern, arbeitete in Chefpositionen für Tageszeitungen, bis er sich 2012 selbstständig machte. Seither schreibt er historische Sachbücher. Unter anderem sind von ihm eine Neuausgabe der Luzerner Diebold-Schilling-Chronik und die Geschichte der Suva erschienen.
Produktdetails
Stefan Ragaz, «Von Land zu Land»
320 Seiten, 18,5 × 26 cm
broschiert, Softcover
ISBN 978-3-905927-72-6


